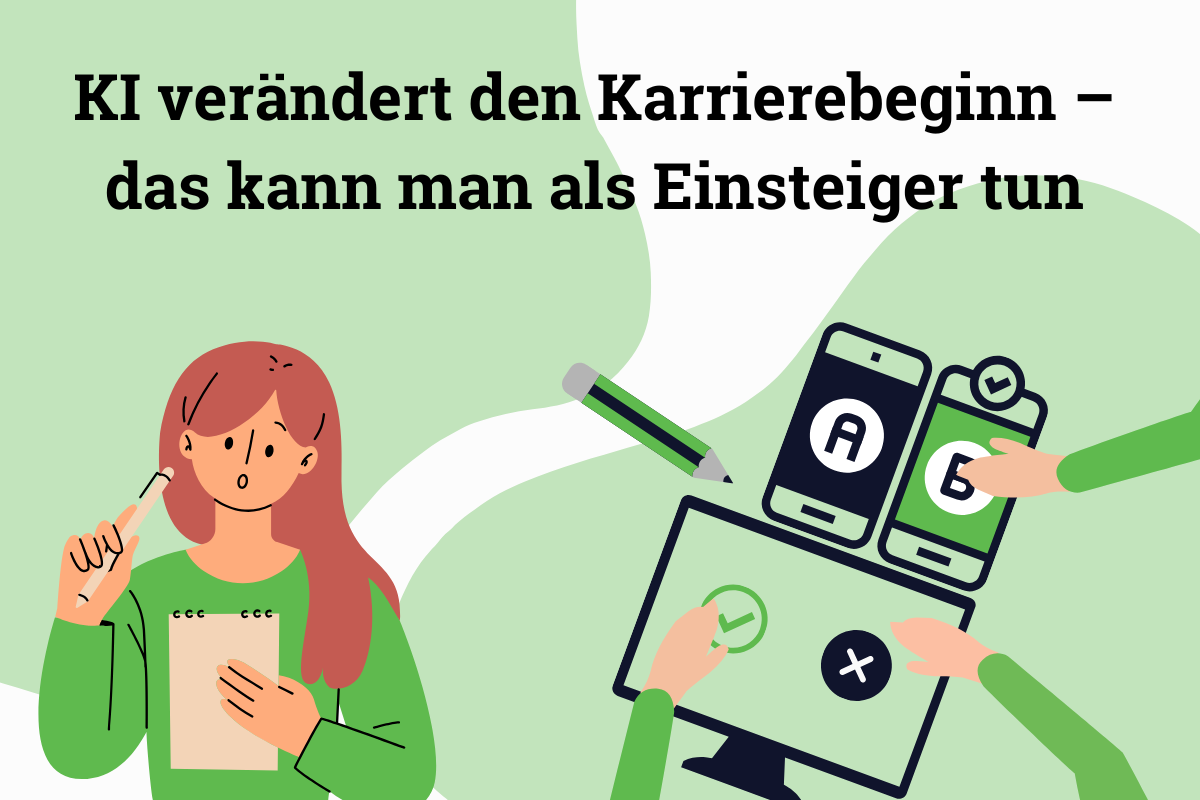Immer mehr Unternehmen integrieren KI in ihre Abläufe – mit dem Nebeneffekt, dass klassische Einstiegspositionen seltener und der Arbeitsmarkt für Berufseinsteiger anspruchsvoller wird.
Eine aktuelle Studie der Stanford University zeigt: Besonders junge Berufseinsteiger (22–25 Jahre) spüren die Folgen.
Sie haben weniger Möglichkeiten, erste Praxiserfahrung zu sammeln und ins Berufsleben hineinzuwachsen. Auf lange Sicht gefährdet das auch die Entwicklung des dringend benötigten Fachkräftepools in den Unternehmen.
Hinzu kommt, dass sich immer mehr Absolventen auf ein schrumpfendes Angebot an Einstiegsjobs bewerben – der Konkurrenzdruck steigt.
Junge Arbeitnehmer verlieren schneller den Anschluss
Die Auswertung von über vier Millionen US-Payroll-Daten in der Studie der Stanford University macht deutlich: In Berufen mit hoher KI-Exposition – etwa Softwareentwicklung oder Kundenservice – ist die Beschäftigung von 22- bis 25-Jährigen seit Ende 2022 um bis zu 20 Prozent zurückgegangen.
Ältere Kollegen in denselben Berufen sind bislang kaum betroffen, teilweise steigt ihre Beschäftigung sogar.
Der Grund: Berufseinsteiger übernehmen vor allem standardisierte Tätigkeiten, die von KI-Systemen inzwischen erledigt werden können. Erfahrene Fachkräfte bringen dagegen Praxiswissen, Routinen und Projektsteuerungskompetenzen mit – Fähigkeiten, die schwerer zu ersetzen sind.
Die Studie zeigt zudem: Unternehmen reagieren nicht über Löhne, sondern über Einstellungen. Weniger Nachwuchs wird eingestellt, während bestehende Teams stabil bleiben.
Wo KI ersetzt – und wo sie unterstützt
Besonders kritisch sind Tätigkeiten, die sich vollständig automatisieren lassen.
Dort sinkt die Nachfrage nach jungen Kräften spürbar. In Jobs, in denen KI vor allem unterstützend eingesetzt wird, bleiben die Beschäftigungschancen stabil oder verbessern sich sogar.
KI kann unterstützend wirken, anstatt Aufgaben vollständig zu übernehmen. In Projekten hilft sie, Informationen zu strukturieren, Besprechungsnotizen zu erstellen oder Handlungsempfehlungen vorzuschlagen – die Entscheidung liegt jedoch weiterhin beim Menschen.
Ähnliches gilt im Marketingsektor: die KI liefert Text- oder Bildideen, die Kreativteams anschließend anpassen und verfeinern.
Auch in der Rechtsberatung kommt die Künstliche Intelligenz zum Einsatz, indem sie große Datenmengen schnell durchsucht und relevante Quellen findet. Die juristische Bewertung bleibt aber klar bei den Fachleuten.
Was Berufseinsteiger jetzt tun können
Die Ergebnisse der Stanford-Studie sind ein Warnsignal – aber kein Grund für Resignation. Sie zeigen Berufseinsteigern klar, welche Kompetenzen den Unterschied machen:
- Grundlagen in KI verstehen: Ein solides Verständnis dafür, wie KI funktioniert und praktisch genutzt werden kann, wird zum neuen Standard.
- Kompetenzen aufbauen, die nicht automatisierbar sind
Auch Soft Skills wie Kreativität, Teamführung, Kommunikation und Problemlösung gehören zu den Fähigkeiten, die gerade im digitalen Wandel entscheidend bleiben.
- Erfahrung sammeln – auch über Umwege: Wenn klassische Einstiegsstellen fehlen, helfen Praktika, Traineeprogramme oder projektbasierte Mitarbeit. So entsteht das Erfahrungswissen, das später schwerer zu ersetzen ist.
- Netzwerke nutzen: Mentoren, Alumni-Programme und Fach-Communities eröffnen Chancen, die über Stellenanzeigen hinausgehen.
- Weiterbildung ernst nehmen: Eine McKinsey-Studie (2025) zeigt: Unternehmen, die früh in Weiterbildung investieren, sind deutlich widerstandsfähiger. Zertifikate, Bootcamps und praxisnahe Kurse sind wertvolle Bausteine neben dem Studium.
Bei Verve Consulting unterstützen wir die neuen Mitarbeiter übrigens ganz konkret: In unserer Verve Academy vermitteln wir praxisnahe Future Skills.